Dieser Text beschreibt Verhaltensweisen von Gruppen, die die Gefahr von Handlungsfehlern stark erhöhen. Die Symptome treten dann häufig auf, wenn sich Gruppen in einer schwierigen Lage befinden und die Mitglieder mit diesen Methoden versuchen ihr Kompetenzbefinden zu stärken.
Die psychologischen Mechanismen, die bei Gruppen ablaufen, sind deswegen besonders wirksam, weil wir durch die Ansichten, Meinungen und Handlungsweisen anderer immer dann besonders beeinflussen lassen, wenn diese „wie aus einem Guss“ wirken.
Inhalt
Unverwundbarkeits-Illusion
Die Mitglieder von Gruppen neigen häufig dazu, sich allesamt weit zu überschätzen. Diese Selbstüberschätzung kann durch eine Art Wechselwirkung entstehen: Gruppenmitglieder halten sich selbst für bedeutender, weil sie glauben einer Gruppe interessanter und begabter Zeitgenossen anzugehören. Diese Einschätzungen können sich gegenseitig hochschaukeln, bis die Fähigkeiten der eigenen Gruppe grotesk überschätzt werden. Man kann dieses Phänomen bei einem Rockerclub genauso antreffen, wie bei einem Führungsteam eines internationalen Konzerns.
Glauben an die moralische Überlegenheit der Gruppe Auch dieses Symptom funktioniert in ganz ähnlicher Weise. Gerade im Konkurrenzkampf in der Wirtschaft, aber auch bei Gruppen von Sportanhängern und leider klassischerweise auch bei Kriegsparteien gründet sich die angebliche eigene Überlegenheit nicht nur auf die (angeblich) eigenen größeren Fähigkeiten, sondern auch auf der angeblich größeren moralischen Integrität. Gerade in schwierigen Situationen rücken die Menschen, die in einer Gruppe zusammenarbeiten, enger zusammen und bestärken sich auf diese Weise.
Stereotypisierung von Außenstehenden
In einer Lage, in der man die „eigenen Leute“ für intellektuell und moralisch überlegen hält und sich auf diese Weise ein doch sehr vereinfachtes Bild der Lage zurechtlegt, dient der Außenstehende als Kontrastprogramm. Die Tendenz verstärkt sich, ihn wahlweise für moralisch verwerflich oder unterlegen zu halten. Das erstere entschuldigt Misserfolge (sie sind z.B. das Ergebnis einer Verschwörung von Gegnern oder unlauteren Machenschaften der Konkurrenz), das zweite macht Hoffnung
Kollektive Rationalisierung
Gruppen, die in eine schwierige Situation geraten sind, sind besonders gefährdet, „zu einfache“ Modelle für Misserfolge zu entwickeln (also z.B. den Fehler der Zentralreduktion zu begehen). Besonders typisch ist dabei, dass die Ursachen außerhalb der Gruppe gesucht werden. Solche Erklärungen werden gerne allseitig akzeptiert, sie gefährden nicht den Zusammenhalt in der der Gruppe und ermöglichen es, eigene Fehler und Schwächen nicht zur Kenntnis zu nehmen.
Gruppendruck auf Außenseiter
Die beschriebenen Tendenzen werden durch eine Reihe von Verhaltensweisen unterstützt. Auffällig ist, dass in kritischen Situationen abweichende Meinungen (möglicherweise sogar noch mit unangenehmen Inhalt) mit Druck auf denjenigen abgegolten werden, der sie vertritt. Dies kann bis zu aggressiven persönlichen Anfeindungen gegen „Miesmacher“ und „Querulanten“ gehen. Auf diese Weise werden, unangenehme Informationen aus der Diskussion ausgeschlossen, mögliche bessere Handlungsalternativen bleiben unerkannt.
Selbsternannte Meinungswächter in der Gruppe Derartige Personen verstärken den Gruppendruck meist in extremer Weise. Sie sind meist im Umfeld autoritärer Führungspersönlichkeiten angesiedelt und versuchen sich durch besonders kompromisslose Durchsetzung der vorgegebenen Linie bei diesen ins rechte Licht zu rücken.
Selbstzensur in allen Einzelheiten
Wer sich in einem derartigen Klima befindet, wie eben beschrieben, ist daher lieber still, wenn er anderer Meinung ist. Die Entwicklung kann aber sogar noch weitergehen. Viele Personen versuchen in solch einer Lage von vornherein, Zweifel im Keim zu ersticken und ihr Denken in andere Bahnen zu lenken. Verhalten sich viele Mitglieder einer Gruppe so, stehen abweichende Meinungen überhaupt nicht mehr zur Diskussion: Der Einzelne, der zweifelt, verbirgt diesen Zweifel und weil auch alle anderen das tun, hält er sich selbst deswegen für einen Außenseiter. Um dieser unangenehmen Rolle zu entgehen, wird er durch die scheinbare Einstimmigkeit häufig wieder auf den Pfad der Gruppenmeinung zurückgeführt.
Die Illusion der Einstimmigkeit in der Gruppe
Mit der Überschrift ist der der Endpunkt der Entwicklung umschrieben: Zweifel werden bereits anfangs erstickt. Die Gruppenmitglieder sind einer Meinung. Weil sie es sind, halten sie ihre Meinung für richtig. Alternativen sind nicht bekannt. Da die „Anderen“ entweder dumm oder böse sind, bedeutet ihre Meinung nichts.
Ein derartiges System an Überzeugungen ist stabil und kaum zu durchbrechen. Es kann im Extremfall zu Katastrophen führen. Kollektive Sektenselbstmorde sind wahrscheinlich als Extremfall der beschriebenen gruppenpsychologischen Prozesse aufzufassen. Aber auch im Arbeitsleben sind sie verhängnisvoll. Sie führen dazu, dass Projekte oder ganze Unternehmen manchmal trotz unübersehbarer Warnzeichen in den Abgrund geführt werden.
Konstellationen, die das Gruppendenken begünstigen
- Starker Zusammenhalt in der Gruppe
- Isolation der Gruppe vom der Außenwelt
- Direktiver Führungsstil
Literatur zum Thema Groupthink
Wer sich etwas mehr mit diesem Thema beschäftigen möchte, dem empfehlen wir die folgenden Bücher:
- Strategische Handlungsflexibilität, Bundesinst. für Berufsbildung, 3-7639-0653-3*
- Logik des Misslingen, Dietrich Dörner, 3-499-61578-9*
- Die Kunst vernetzt zu denken, Frederic Vester, 3-423-33077-5*
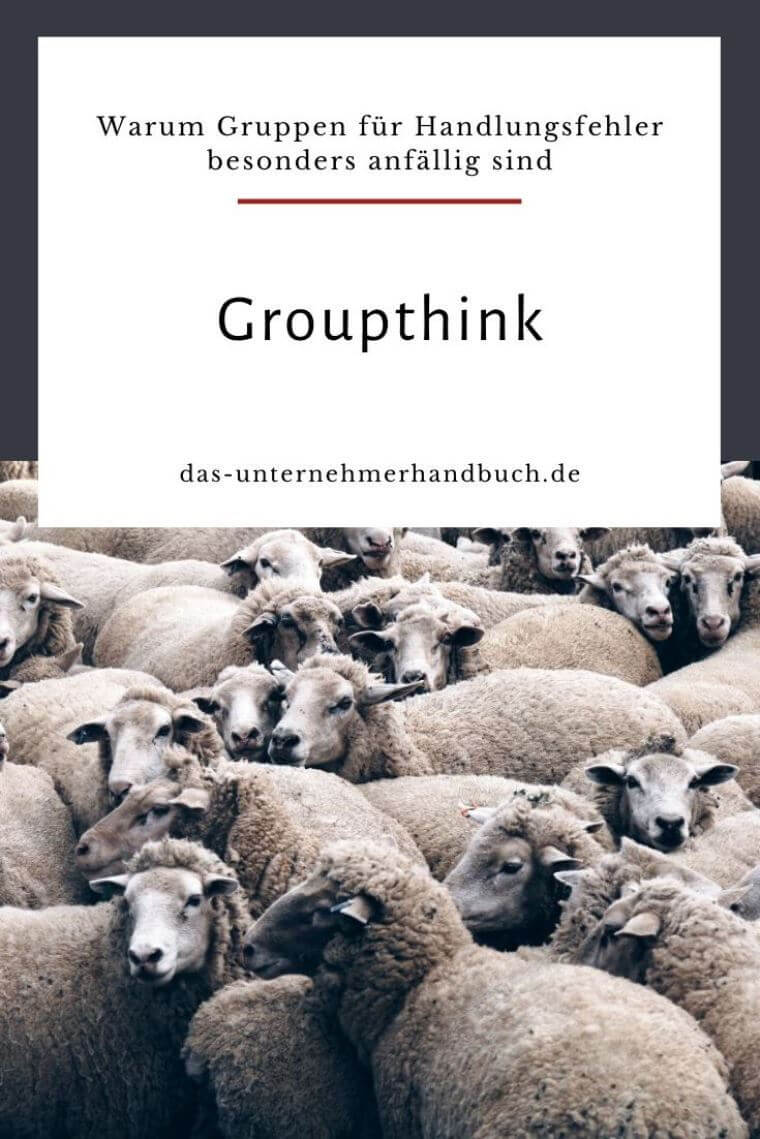
Pin it!


[…] Groupthink – oder warum Gruppen für Handlungsfehler besonders anfällig sind […]